Akzeptanz ist kein Aufgeben – sondern ein Anfang
„Ich habe alles versucht, aber nichts hat sich geändert.“
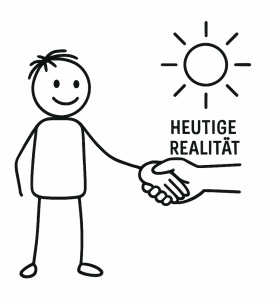
Franziska sitzt mir gegenüber. Die Schultern hängen, die Hände fest um ihre Kaffeetasse geschlossen. Sie ist seit über 20 Jahren in der Pflege, auf der Palliativstation erfahren, beliebt, professionell. Und trotzdem wirkt sie heute – leer. „Ich weiß nicht, was ich noch machen soll“, sagt sie leise. Ihre Stimme zittert. Dann erzählt sie von dem Patienten, der seit Tagen gegen sein Sterben kämpft. Von der Tochter, die schreit, weint, fordert. Und von sich selbst: „Ich war so wütend. Wütend, weil ich nichts tun konnte. Wütend, weil ich mich verantwortlich gefühlt habe für etwas, das ich nicht ändern kann.“
Ein Satz bleibt hängen: „Ich dachte, ich muss nur mehr tun. Aber irgendwann war klar: Ich kann die Realität nicht wegpflegen.“
Was Franziska in diesem Moment erlebt hat, war ein Schlüsselmoment der Akzeptanz. Und genau um diesen Wendepunkt geht es in diesem Artikel.
Akzeptanz als Resilienzfaktor
In der Resilienzforschung gilt Akzeptanz als einer der zentralen Schutzfaktoren. Sie beschreibt die Fähigkeit, die Dinge so anzunehmen, wie sie sind – ohne sie sofort verändern zu müssen. Klingt banal? Ist es aber nicht. Denn viele von uns sind es gewohnt, Probleme zu lösen, Situationen zu verbessern oder wenigstens „das Beste draus zu machen“.
Vielleicht ist das auch Dein innerer Anspruch, geprägt durch die Sozialisation im Pflegeberuf: „Hilf den Menschen“, „Tu irgendetwas“ – und gleichzeitig ist es oft die Erwartung von Patientinnen, Angehörigen oder anderen Berufsgruppen im Gesundheitswesen: „Mach heile“, „Kümmer Dich“, „Tu etwas, auch wenn es unmöglich erscheint.“
Vielleicht klebt an Deiner Berufsrolle Hoffnung. Vielleicht sogar letzte Hoffnung. Und die Vorstellung, dass sich bitte doch noch alles ändern möge. Doch was, wenn nichts mehr zu machen ist? Wenn ein Mensch stirbt. Wenn eine Diagnose unumkehrbar ist. Oder wenn Teamkonflikte bestehen bleiben – trotz aller Bemühungen? Dann hilft keine Optimierung mehr, sondern nur noch eines: Akzeptanz.
Das klingt im ersten Moment nach Achselzucken und „Da kann man halt nichts machen“. Aber für mich ist es die schwerste Haltung, die man einnehmen kann. „Manchmal kann man nichts machen“ – das ist eine Wahrheit, die im jeweiligen Moment kaum greifbar ist.
Wenn Du Akzeptanz übst – und innerlich auch die Frage nach Schuld und Verantwortung klärst – kann Dir diese Haltung Kraft geben. Denn Akzeptanz schafft inneren Raum. Sie befreit Dich von der ständigen Anstrengung, alles im Griff haben zu müssen. Und sie ist der erste Schritt zu innerer Ruhe – gerade in einem Beruf, der so viel Unplanbares mit sich bringt.
Akzeptanz ist kein Rückzug
Immer wieder wird Akzeptanz mit Resignation verwechselt – als würde man die Dinge einfach laufen lassen oder innerlich aufgeben. Doch das ist ein Missverständnis. Akzeptanz bedeutet nicht, alles gutzuheißen oder sich passiv dem Geschehen zu fügen. Vielmehr geht es darum, die Realität zu sehen, wie sie ist – ohne inneren Widerstand, ohne Schönreden, ohne Kampf. Es geht darum, auf das Ringen gegen Unveränderliches zu verzichten und die Kraft auf das zu lenken, was tatsächlich gestaltbar ist.
Das kann bedeuten, nicht länger zu erwarten, dass eine Kollegin ihre ruppige Art plötzlich ablegt. Stattdessen entsteht innerlich Klarheit: So ist sie. Und ich muss meine Energie nicht mehr in einen Kampf investieren, der mich erschöpft, aber nichts verändert. Akzeptanz kann auch heißen, anzuerkennen, dass der Wunsch nach mehr Personal berechtigt ist – und gleichzeitig zu erkennen, dass dieser Wunsch sich heute, in diesem Dienst, mit diesem Team, nicht erfüllen lässt. Es ist eine Haltung, die sich auch gegen Dich selbst richten kann, wenn Du spürst: Ich schaffe heute keine Doppelschicht mehr, ohne innerlich auszubrennen. Früher war das vielleicht anders – heute braucht Dein Körper andere Pausen. Auch das ist Akzeptanz: die ehrliche, liebevolle Begegnung mit dem, was ist.
Dein Einfluss ist begrenzt: Mir helfen manchmal folgende Gedanken:
- Auch wenn ich glaube, dass eine Veränderung meiner Kollegin dem ganzen Team guttun würde – mein Einfluss endet bei mir. Ich kann mich ändern, aber nicht andere.
- Auch wenn ich gerne auf „die gute alte Zeit“ zurückblicke – ich lebe heute. Und gestalte das Morgen.
- Recht haben und Recht bekommen – das ist ein Unterschied. Manchmal muss ich aushalten, dass mein Team Umwege geht, obwohl ich die Abkürzungen gekannt hätte.
Erst wenn ich aufhöre, gegen das zu kämpfen, was ist, bekomme ich wieder Kraft, mich dem zuzuwenden, was ich wirklich beeinflussen kann.
Das Einfluss-Sphären-Modell nach Stephen Covey
Der US-amerikanische Autor Stephen Covey unterscheidet drei Bereiche:
- Sphäre der Kontrolle: Dinge, die Du direkt beeinflussen kannst (z. B. Deine Worte, Haltung, Entscheidungen).
- Sphäre des Einflusses: Dinge, auf die Du indirekt Einfluss nehmen kannst (z. B. Teamklima, Kommunikation, Beziehungen).
- Sphäre der Sorge: Dinge, die Dich beschäftigen, aber außerhalb Deines Einflusses liegen (z. B. politische Entscheidungen, das Verhalten anderer).
Viele verlieren Energie, weil sie versuchen, Dinge in der Sphäre der Sorge zu kontrollieren. Akzeptanz beginnt hier: bei der ehrlichen Einsicht, was Du nicht verändern kannst – und dem Mut, Deine Kraft dorthin zu lenken, wo Du wirklich etwas bewegen kannst.
Akzeptanz üben – fünf Beispiele aus dem Pflegealltag
Umgang mit demenziell erkrankten Menschen: Wenn eine Bewohnerin immer wieder nach ihrer Mutter fragt, hilft keine rationale Erklärung. Die Realität der anderen anzuerkennen, ist ein Akt der Akzeptanz.
- Impuls: Versuchst Du zu überzeugen – oder mitzufühlen?
Grenzen der Institution: Du möchtest mehr Zeit, mehr Zuwendung, mehr Personal – doch das System gibt es nicht her. Akzeptanz schafft Raum für kreative Wege innerhalb dieser Grenzen.
- Impuls: Was wäre, wenn Du nicht mehr gegen das System kämpfst, sondern innerhalb Deiner Möglichkeiten das Beste gestaltest?
Unterschiedliche Haltungen im Team: Nicht jede Kollegin denkt wie Du. Akzeptanz bedeutet hier: Vielfalt anerkennen – und trotzdem in Verbindung bleiben.
- Impuls: Welche Haltung im Team fordert Dich gerade heraus? Was wäre, wenn Du statt Ärger Neugier entwickelst?
Eigene Grenzen anerkennen: Viele Pflegende übergehen ihre eigenen Signale. Akzeptanz beginnt mit dem Satz: „Ich bin müde.“
- Impuls: Was wäre, wenn Du Deinen Körper als Partner und nicht als Gegner betrachtest?
Umgang mit Angehörigen: Nicht jede Reaktion ist fair. Akzeptanz heißt: nicht alles persönlich nehmen – sondern Überforderung als Auslöser erkennen.
- Impuls: Was hilft Dir, professionell zu bleiben, auch wenn es emotional wird?
Alltag als Trainingsfeld für Akzeptanz
Akzeptanz ist keine feste Eigenschaft, mit der Du geboren wirst – sie ist wie ein Muskel, den Du trainieren kannst. Je häufiger Du übst, desto eher wird sie Dir in schwierigen Momenten zur Verfügung stehen. Und genau darin liegt ihre Kraft: Sie entsteht nicht erst in der Krise, sondern im ganz normalen Alltag.
Wenn Dich jemand angreift – zum Beispiel eine Angehörige, die Dich mit vorwurfsvollem Ton konfrontiert: „Wegen Ihnen geht es meiner Mutter jetzt schlechter!“ – dann ist es menschlich, dass Du Dich getroffen fühlst. Vielleicht steigt Ärger in Dir auf oder das Bedürfnis, Dich zu rechtfertigen. Doch in einem Moment der Achtsamkeit kannst Du innehalten und erkennen: Diese Worte erzählen mehr über die Hilflosigkeit der Angehörigen als über Deine fachliche Kompetenz. Akzeptanz bedeutet dann, die Gefühle hinter dem Angriff zu sehen – Angst, Sorge, Kontrollverlust – und Dich nicht persönlich gemeint zu fühlen. Das heißt nicht, alles zu schlucken. Aber Du kannst entscheiden, wie viel inneren Raum Du dem Konflikt gibst.
Oder stell Dir vor, Du steckst im Stau. Du hattest es eilig, vielleicht warst Du auf dem Weg zu einem Termin, bist pünktlich losgefahren – und nun das. Der erste Impuls ist vielleicht Frust, vielleicht sogar Panik. Doch Akzeptanz heißt in diesem Moment: anzuerkennen, dass Du den Stau nicht ändern kannst. Statt Dich aufzuregen oder in Gedanken Katastrophenszenarien zu malen, atmest Du tief durch, informierst die Person, die auf Dich wartet, hörst Radio oder einen Podcast – und erlaubst Dir, die Situation zu nehmen, wie sie ist. Das bringt Dich nicht schneller ans Ziel, aber bewahrt Deine innere Ruhe.
Ein weiteres Beispiel, das viele Eltern kennen: Dein Kind bringt eine Fünf in Mathe mit nach Hause. Vielleicht hattest Du gehofft, es sei begabt, würde mit Leichtigkeit durch die Schule gehen – und nun das. Enttäuschung mischt sich mit Sorge, vielleicht auch mit Stolz, der leise kratzt. Doch Akzeptanz bedeutet hier, die Realität anzunehmen: Dein Kind tut sich schwer. Punkt. Statt zu vergleichen oder zu bewerten („Dein Freund hatte eine Drei“, „Ich war früher besser“) kannst Du den Blick nach vorn richten: Was braucht mein Kind? Welche Unterstützung ist hilfreich? Und vor allem: Wie bleibe ich in Beziehung – auch wenn es anders läuft, als ich es mir vorgestellt habe?
Diese kleinen Szenen sind Übungsfelder. Jeden Tag. Und mit jedem Moment, in dem Du bewusst akzeptierst, was ist – statt Dich dagegen aufzulehnen – stärkst Du Deine Fähigkeit, in großen, existenziellen Herausforderungen mit mehr innerer Klarheit und Gelassenheit zu handeln.
Akzeptanz und Palliative Care
In der Palliativversorgung ist Akzeptanz nicht nur eine Haltung, sondern oft die einzige Möglichkeit. Der Tod ist unausweichlich. Und dennoch versuchen viele, ihn zu kontrollieren, zu verschieben, zu umgehen. Auch Pflegende. Akzeptanz heißt hier: mitgehen statt gegenhalten. Zuhören statt wegtrösten. Da sein, auch wenn nichts mehr zu retten ist. Und Angehörige und Patientinnen dabei zu unterstützen, diese Realität für sich anzunehmen.
Es sind gerade diese Momente, in denen Pflege zur Kunst wird. Und in denen wir dem Leben seine Würde lassen. Und das ist es, was mich an Pflege fasziniert – nicht die Lagerungstechniken, nicht die Waschrichtung und schon gar nicht die delegierten Handlungen von ärztlichen Tätigkeiten, sondern die Chance, Würde zu geben – in für die Patientin und ihre Angehörigen sehr schweren Situationen.
Ein Pfleger berichtete: „Früher habe ich mich für mein Scheitern verurteilt, wenn ich nichts mehr tun konnte. Heute weiß ich: Mein Dasein ist das Entscheidende.“ Diese Haltung verändert nicht nur die Atmosphäre – sie schenkt den letzten Tagen eine neue Tiefe.
Die spirituelle Dimension der Akzeptanz
Am Lebensende verschieben sich oft die Fragen. Es geht nicht mehr um das „Warum ist mir das passiert?“ – sondern um das „Wofür war das gut?“ oder auch: „Was trägt mich jetzt noch?“ In der Begleitung von schwerkranken und sterbenden Menschen erlebe ich immer wieder, wie sehr Akzeptanz eine spirituelle Dimension berührt – leise, tief, jenseits von Worten.
Spirituelle Akzeptanz bedeutet, sich in etwas Größeres einzufügen. Es heißt, nicht alles verstehen zu müssen – aber anzuerkennen, dass auch Schmerz, Verlust und Endlichkeit einen Platz im Leben haben dürfen. Dass es vielleicht kein klares Ziel mehr gibt, aber dennoch Sinn im Dasein liegt. Manche Menschen finden Trost im Glauben, im Gebet oder in Ritualen, die ihnen vertraut sind. Andere finden diesen Halt in der Natur – in einem Baum, der Jahrhunderte überdauert, in der Stille eines Morgens, im Kreislauf der Jahreszeiten. Wieder andere finden ihn in Musik, in der Nähe zu einem geliebten Menschen oder einfach in einem Moment des echten Daseins – wenn jemand einfach nur da ist, ohne etwas tun zu müssen.
Die spirituelle Haltung fragt nicht mehr: „Wie komme ich da wieder raus?“ – sondern vielmehr: „Wie kann ich in dieser Erfahrung ganz ich selbst bleiben?“ Wie kann ich trotz allem Mensch bleiben, spüren, fühlen, verbunden sein? Für mich liegt in dieser Haltung eine große Würde. Es ist kein resigniertes Loslassen, sondern ein tiefes Einverstandensein mit dem, was größer ist als wir. Und vielleicht beginnt genau hier eine andere Art von Frieden.
Fünf Wege, Akzeptanz zu stärken
- Realität benennen: Sag Dir selbst, was ist – ohne Bewertung.
- Unterscheiden lernen: Kann ich das ändern? Wenn nicht: loslassen.
- Im Jetzt ankommen: Nicht „Früher war alles besser“, sondern: „Wie ist es heute?“
- Mitgefühl statt Widerstand: Auch Dir selbst gegenüber.
- Ressourcen aktivieren: Sprich darüber, schreib auf, bleib in Kontakt.
Reflexionsfragen für Deinen Alltag
- Welche Situation fordert mich gerade heraus, weil ich sie nicht ändern kann?
- Wo verliere ich Energie, weil ich gegen etwas kämpfe, das unveränderlich ist?
- Was würde sich verändern, wenn ich annehme, was ist?
- Wo kann ich loslassen, ohne aufzugeben?
- Was hilft mir, im Jetzt zu bleiben – auch wenn es schwer ist?
- Woran merke ich, dass ich zu viel Energie auf etwas verwende, das außerhalb meines Einflusses liegt?
Akzeptanz ist kein Endpunkt. Sie ist ein Startpunkt für neue Gedanken, neue Kraft und neue Wege. Sie macht Dich nicht passiv – sondern handlungsfähig. Und sie schenkt Dir Klarheit für das, was zählt.
Oder wie Viktor Frankl es ausdrückte:
„Wenn wir eine Situation nicht ändern können, müssen wir uns selbst ändern.“
Diesen Artikel dürfen und können Sie hier gern als pdf-Datei herunterladen: Artikel



