Ekel am Lebensende – über Nähe, Würde und Grenzen in der Palliative Care
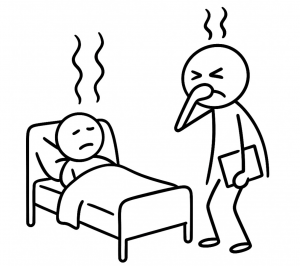
Ekel am Lebensende – über Nähe, Würde und Grenzen in der Palliative Care
Ich stand in meiner Küche, als mich plötzlich eine Erinnerung überfiel. Ohne Vorwarnung war ich wieder acht oder neun Jahre alt und stand in der Wohnung einer Familie aus meiner Grundschulzeit. Ihre Tochter Tanja war in meiner Klasse, ich mochte sie, und doch fühlte ich mich damals seltsam unwohl, wenn ich dort war. Ich erinnere mich an den Geruch, an die vielen Katzen, an das klebrige Geschirr auf dem Tisch. An dieses eigentümliche Gefühl, das ich nicht benennen konnte – heute würde ich sagen: Es war Ekel.
Er kam damals leise, aber deutlich. Ein körperliches Ziehen, ein Reflex, der etwas in mir schützen wollte. Und während ich da in meiner Küche stand, Jahrzehnte später, war dieses Gefühl plötzlich wieder da. Ohne Anlass, aber unverkennbar.
Seltsam, dachte ich da stehend in der Küche, dass mir diese Erinnerung, die etwa 35 Jahre her sein muss, plötzlich einfällt. Da waren doch noch krassere Ekelerlebnisse in meinem Leben – besonders in meiner Zeit als aktive Pflegekraft: Patienten, die Ausscheidungen aßen, Wundgerüche, abgeleckte Zahnprothesen, explosionsartige Darmentleerungen, Blut, Alter, Tod, Operationen, Sputum und vieles mehr. Ich habe mich unfassbar oft geekelt und dabei professionell getan – schließlich ist das die Königsdisziplin: frühstücken und gleichzeitig über Erbrochenes sprechen. Das kann man halt, wenn man Pflegende ist. Oder?
Ekel ist eines der ehrlichsten Gefühle, die wir haben – und eines der unbequemsten. Er zeigt uns, wo unsere Grenzen liegen. Und in der Pflege ist er ein ständiger, oft unausgesprochener Begleiter. Ob in der direkten Körperpflege, bei Gerüchen, beim Kontakt mit Ausscheidungen oder in Momenten, die uns emotional zu nahe gehen – Ekel gehört dazu. Doch kaum jemand spricht darüber.
Ekel – ein Schutz, kein Versagen
Ekel ist keine Schwäche, sondern ein Schutzmechanismus. Er entsteht blitzschnell, meist unwillkürlich, und soll uns davor bewahren, etwas Gefährliches oder Belastendes zu nah an uns heranzulassen. In der Pflege ist dieser Mechanismus besonders herausfordernd, weil er sich gegen genau das richtet, was wir beruflich tun: Nähe herstellen, pflegen, berühren.
Viele Pflegende empfinden Ekel nicht nur im körperlichen Sinn, sondern auch auf emotionaler Ebene – etwa, wenn ein Mensch sehr aggressiv, ablehnend oder enthemmt ist. Manchmal entsteht Ekel, wenn jemand in seiner Krankheit oder Verzweiflung jede Grenze überschreitet oder wenn Worte und Gerüche zusammen eine Atmosphäre schaffen, die schwer auszuhalten ist. Auch der Kontakt mit einem verstorbenen Menschen kann Ekel auslösen – nicht, weil der Tod abstößt, sondern weil der Körper in seinem Verfall etwas in uns berührt, das wir instinktiv auf Distanz halten möchten.
Ekel zeigt sich auch dort, wo Verwahrlosung, Hilflosigkeit oder Traurigkeit den Raum erfüllen. Wenn Kleidung, Atem oder Haut den Geruch von Einsamkeit tragen. Wenn jemand nicht mehr fähig ist, sich selbst zu pflegen, und wir den Verfall unmittelbar spüren. Dann mischt sich Ekel oft mit anderen Gefühlen: Mitleid, Ohnmacht, Scham – und manchmal auch Ärger. Ärger darüber, dass man sich so fühlt, obwohl man doch helfen will.
Ekel hat viele Gesichter. Er ist ein zutiefst menschliches Gefühl, das uns an unsere Grenzen erinnert – und daran, dass Pflege nicht nur eine körperliche, sondern immer auch eine seelische Arbeit ist. Wer ihn wahrnimmt, ohne sich dafür zu verurteilen, kann lernen, ihn zu verstehen – als Signal, das zeigt: Hier brauche ich Schutz, Zeit, Abstand oder einfach Verständnis.
Gerade diese Mischung macht ihn so schwer auszuhalten. Denn wer sich ekelt, fühlt sich schnell schuldig. „Ich darf das nicht fühlen. Ich bin doch Pflegende.“
Doch genau das Gegenteil ist richtig: Ekel zeigt, dass wir sensibel wahrnehmen – und dass wir uns innerlich abgrenzen müssen, um professionell bleiben zu können.
Wenn Nähe an Grenzen stößt
Pflege bedeutet, Menschen in ihrer Verletzlichkeit zu begegnen. Haut, Körperflüssigkeiten, Gerüche, Sterbensprozesse – all das ist Teil des Alltags. Doch auch wenn es Routine wird, bleibt der Körperkontakt nie neutral. Es gibt Tage, an denen der Geruch eines Dekubitus oder der Anblick eines stark abgemagerten Körpers uns stärker trifft als sonst.
Ekel kann sich in solchen Momenten ganz körperlich zeigen: ein Ziehen im Bauch, ein flacher Atem, Gänsehaut, manchmal der Impuls, den Kopf abzuwenden. Das ist menschlich. Wichtig ist, es wahrzunehmen, statt es zu verdrängen. Denn wer Ekel dauerhaft unterdrückt, verliert irgendwann die Fähigkeit zur Empathie oder reagiert mit Zynismus – als Selbstschutz.
Professionelle Haltung bedeutet nicht, keine Gefühle zu haben. Sie bedeutet, sie zu erkennen, zu reflektieren und mit ihnen umgehen zu lernen.
Zwischen Scham und Sprachlosigkeit
Über Ekel zu sprechen, fällt vielen schwer. Er gilt als peinlich, unprofessionell oder sogar unmoralisch. Kaum jemand erzählt im Team: „Ich habe mich heute geekelt.“ Stattdessen wird geschwiegen – oder mit Humor überdeckt.
Und wir sind oft aufgebracht, wenn Außenstehende den Pflegeberuf mit Ekel in Verbindung bringen.
„Als wenn ich den ganzen Tag mit Erbrochenem und Ausscheidungen zu tun hätte“, empörte sich eine Pflegende, die es satt hat, dass der Beruf manchmal auf „eklige Aufgaben“ reduziert wird. Dieses Missverständnis trifft mitten ins Herz – weil es nicht sieht, was Pflege wirklich bedeutet: Menschlichkeit, Zuwendung, Nähe.
Doch genau dieses Schweigen über den eigenen Ekel verstärkt das Problem. Denn Ekel will verarbeitet werden. Wenn er keinen Ausdruck findet, bleibt er im Körper und sucht sich andere Wege: als Anspannung, Gereiztheit, Distanz oder innere Müdigkeit. Viele spüren irgendwann nur noch eine diffuse Abwehr – gegen Gerüche, gegen bestimmte Bewohner:innen oder gegen ganze Situationen.
Manchmal reicht schon ein Satz, um Erleichterung zu schaffen:
„Heute war das schwer auszuhalten.“
„Ich musste kurz Abstand gewinnen.“
„Ich habe mich erschrocken, dass mir das so naheging.“
Solche Sätze öffnen Räume. Sie zeigen, dass Ekel kein persönliches Versagen ist, sondern Teil der emotionalen Realität in der Pflege. Wer das aussprechen darf, bleibt innerlich beweglich. Denn wo Gefühle einen Namen bekommen, kann Verständnis wachsen – für sich selbst und füreinander.
Ekel und Palliative Care
In der palliativen Begleitung zeigt sich Ekel oft dort, wo die Körperlichkeit des Sterbens besonders spürbar wird: Gerüche, Ausscheidungen, Hautveränderungen, Mundgeruch, Atem, Wunden. Hier sind Nähe, Fürsorge und Würde zentrale Werte – und gleichzeitig kann das Bedürfnis entstehen, Distanz zu schaffen.
Diese Spannung auszuhalten, gehört zur Kunst der palliativen Pflege. Denn Ekel entsteht nicht gegen die Person, sondern gegen die Situation. Es hilft, sich das immer wieder bewusst zu machen:
Ich ekle mich nicht vor dem Menschen, sondern vor dem Zustand.
Diese Differenzierung ermöglicht Mitgefühl, ohne sich zu überfordern.
Vielleicht entsteht gerade in der Hospizarbeit manchmal der Eindruck, dass Ekel keinen Platz haben darf. Vielleicht sprechen wir dort so viel von Würde, Liebe und dem Loslassen, dass der Alltag mit all seiner Körperlichkeit ein wenig in den Hintergrund tritt. Vielleicht hat sich eine Sprache entwickelt, die so sehr auf die Schönheit der Begleitung zielt, dass die Realität leiser wird. Und vielleicht führt genau das dazu, dass wir beginnen, unsere eigenen widersprüchlichen Empfindungen zu tabuisieren – aus Sorge, dem hohen Anspruch der Hospizarbeit nicht gerecht zu werden.
Dabei wäre es doch viel ehrlicher – und zutiefst menschlich –, beides benennen zu dürfen:
„Ich habe diesen Menschen gerne am Lebensende begleitet – und gleichzeitig war der Wundgeruch für mich grenzwertig.“
Solche Sätze nehmen nichts von der Würde des Sterbens. Im Gegenteil: Sie machen sie greifbarer. Sie holen die Begleitung zurück auf den Boden der Wirklichkeit – dorthin, wo Pflege und Menschlichkeit tatsächlich stattfinden: im Kontakt zwischen Körper und Gefühl, zwischen Zuwendung und Abgrenzung.
In der palliativen Arbeit kann auch das Umfeld Ekelgefühle auslösen – etwa Angehörige, die in ihrer Überforderung keine Hygiene mehr schaffen, Wohnungen, die nach Krankheit riechen, oder das Gefühl, „nicht genug Luft“ zu bekommen. Wer das benennt, schafft Raum für Selbstschutz und gegenseitige Unterstützung im Team. Denn wo Gefühle geteilt werden dürfen, bleibt Menschlichkeit lebendig – auf beiden Seiten.
Strategien im Umgang mit Ekel
Ekel lässt sich nicht abschalten – aber er lässt sich regulieren.
Einige bewährte Strategien sind:
- Atmung bewusst lenken: tief durchatmen, den Fokus auf den Rhythmus legen – das reduziert die körperliche Stressreaktion.
- Kurze Distanzpausen einbauen: ein Moment am Fenster, frische Luft, Wasser trinken.
- Gerüche neutralisieren: Eukalyptusöl, Pfefferminz, Kaugummi oder Mentholcreme unter der Nase – kleine Rituale mit großer Wirkung.
- Teamoffenheit fördern: Wenn Ekel ausgesprochen werden darf, verliert er seine Scham.
- Supervision nutzen: Emotionale Reflexion schafft Klarheit und schützt vor Überforderung.
- Humor zulassen: Nicht als Verharmlosung, sondern als Ventil, das Spannung löst und Verbundenheit schafft – ohne die Haltung zu gefährden.
Ekel, Empathie und Selbstfürsorge
Interessanterweise sind gerade die empathischsten Pflegenden besonders empfänglich für Ekel – weil sie offen wahrnehmen, was andere vermeiden. Doch genau diese Sensibilität ist eine Stärke – sie braucht nur einen bewussten Rahmen.
Ekel zeigt Grenzen. Wer ihn anerkennt, kann besser entscheiden:
Wie nah möchte ich jetzt sein?
Was brauche ich, um handlungsfähig zu bleiben?
Wo endet meine Verantwortung – und wo beginnt meine Selbstfürsorge?
Pflegende, die lernen, mit ihrem Ekel professionell umzugehen, bewahren ihre Fähigkeit zu Nähe, Mitgefühl und Humor.
Nicht trotz, sondern gerade wegen dieser ehrlichen Emotion.
Reflexionsfragen für Pflegende
- Wann habe ich zuletzt in meiner Arbeit Ekel empfunden – und wie bin ich damit umgegangen?
- Welche körperlichen Signale nehme ich wahr, wenn ich mich ekle?
- Wie gehe ich im Team mit solchen Gefühlen um – gibt es Raum dafür?
- Was hilft mir, innerlich wieder ins Gleichgewicht zu kommen?
- Welche Form von Humor oder Leichtigkeit kann mir helfen, Distanz zu schaffen, ohne abzustumpfen?
Ekel als Teil professioneller Menschlichkeit
Ekel ist kein Makel, sondern ein Hinweis.
Er zeigt, wo wir als Menschen empfindsam bleiben – und wo wir Schutz brauchen.
Pflegearbeit, besonders in der Palliative Care, verlangt eine Nähe, die berührt und verändert.
Sie gelingt dann am besten, wenn wir auch die schwierigen Gefühle ernst nehmen.
Denn wer Ekel verstehen lernt, versteht etwas Grundlegendes über Menschlichkeit:
Dass sie nie steril ist.
Und dass Würde und Abgrenzung sich nicht ausschließen – sondern gegenseitig schützen.
Vielleicht bleibt Ekel deshalb so lange in unserer Erinnerung – wie ein Geruch, ein Bild, ein Gefühl, das nicht vergeht. Er zeigt uns, dass Nähe immer etwas kostet. Und dass es keine Hierarchie des Ekels gibt: Ob es der Geruch einer Wunde, eine alte Kindheitserinnerung oder die Begegnung mit Sterblichkeit ist – jedes dieser Erlebnisse hat seine eigene Wahrheit.
Ekel erinnert uns daran, dass wir fühlen, auch dann, wenn wir lieber nicht möchten. Und vielleicht ist genau das seine leise Botschaft:
Dass wir als Pflegende nicht nur mit unseren Händen, sondern immer auch mit unserer ganzen Menschlichkeit arbeiten.
In Fortbildungen oder Teamgesprächen kann das Thema Ekel Türen öffnen – für Ehrlichkeit, Selbstschutz und gegenseitige Unterstützung. Denn wo das Unsagbare einen Namen bekommt, entsteht wieder Raum für Menschlichkeit.
„Ekel ist der Versuch der Seele, sich zu schützen, wenn der Körper zu nah kommt.“ — frei nach Paul Ekman
Diesen Artikel dürfen und können Sie hier gern als pdf-Datei herunterladen: Artikel



